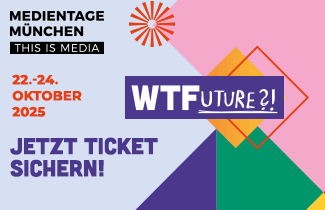Das Landgericht Berlin hat ein wegweisendes Urteil zur Verhandlung gemeinsamer Vergütungsregeln (GVR) gefällt. Im Zentrum steht die Frage, wer berechtigt ist, solche Regeln für bestimmte kreative Berufe im Film- und Medienbereich auszuhandeln.
Ver.di darf nicht für alle Berufsgruppen verhandeln
Konkret untersagt das Gericht der Gewerkschaft ver.di, GVR für Berufsfelder wie Synchronregie und Dialogbuch abzuschließen, solange sie diese Bereiche nicht repräsentativ vertritt. Das Urteil vom 13. Mai 2025 (Az.: 15 O 397/24) erging im Verfahren des Bundesverbands Synchronregie und Dialogbuch e.V. (BSD) gegen ver.di.
Hintergrund ist eine gemeinsam mit dem Schauspielverband BFFS und dem Tonverband BVFT verhandelte GVR mit Netflix. Diese Vereinbarung umfasste auch die Tätigkeiten Synchronregie und Synchronbuch – obwohl ver.di und die beteiligten Verbände dort laut BSD keine ausreichende Repräsentanz besitzen.
Gericht bestätigt Sichtweise des BSD
Das Gericht folgt der Argumentation des BSD. Es stellt klar: Repräsentativität im Sinne des § 36 UrhG muss sich konkret auf das jeweilige Berufsfeld beziehen. Eine pauschale Vertretung „für die Filmbranche“ reiche nicht aus, um GVR rechtswirksam abzuschließen. Daher sei ver.di nicht berechtigt, in Bereichen wie Synchronregie oder Dialogbuch mit Netflix Vereinbarungen zu treffen.
Signalwirkung für die Branche
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, entfaltet jedoch bereits Wirkung. Es bringt Klarheit für Berufsverbände und stärkt die Rolle spezialisierter Urheberorganisationen im Prozess kollektiver Vergütungsverhandlungen. Der BSD sieht seine Position bestätigt. Auch die Verbände der UrheberAllianz Film & Fernsehen begrüßen die Entscheidung. Sie hoffen, dass künftige GVR-Verhandlungen stärker an den gesetzlichen Maßstäben ausgerichtet werden.
Hintergrund: Gemeinsame Vergütungsregeln
GVR dienen dazu, faire Vergütungen für kreative Tätigkeiten zu vereinbaren, wenn individuelle Verhandlungen aufgrund struktureller Ungleichgewichte schwierig sind. Sie sind rechtlich im Urheberrechtsgesetz (§ 36 UrhG) geregelt und müssen zwischen repräsentativen Organisationen auf beiden Seiten – Urheber und Verwerter – ausgehandelt werden.
Mit dem aktuellen Urteil konkretisiert das Landgericht Berlin, was „repräsentativ“ in diesem Zusammenhang bedeutet – und wer im Namen kreativer Berufsgruppen sprechen darf.