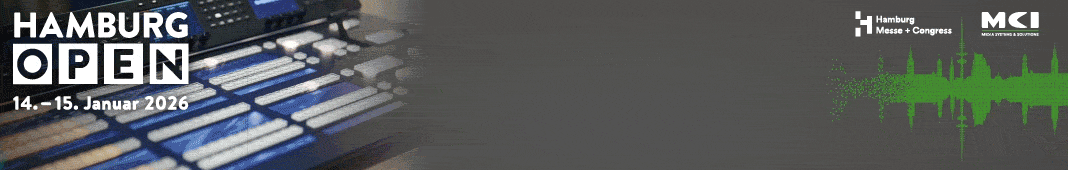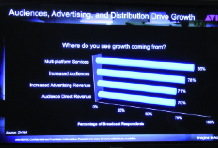Eine beliebte Frage bei der Stoffentwicklung lautet: „Soll man beim Drehbuchschreiben an das Publikum denken?“ Immerhin sind sie letztendlich die „Abnehmer“ eines Films. Beim Fernsehen scheint das Schreiben für das Publikum leidlich zu funktionieren, denn es ist der deutsche Kinofilm, der unter Publikumsmangel leidet. Daher wurde die Frage auch an Kinomacher gerichtet und die Antwort war erwartungsgemäß eindeutig: Natürlich muss man für das Publikum schreiben! Ein kolossaler Fehler wäre es allerdings sich am Reißbrett einen „Publikumsfilm“ auszudenken. „Ein Film muss einen Kerngedanken haben, von dem alles ausgeht“, sagt Benjamin Hermann, Geschäftsführer von Majestic Film und Produzent von „Wüstenblume“ oder „Tom Sawyer“. Erst wenn das Thema eines Films ausreichend entwickelt ist, kann der Marktgedanke einsetzen. Aus Sicht des Produzenten ist das die finanzielle Machbarkeit. Jürgen Fabritius, Geschäftsführer von 3rosen, erklärt: „Der Zuschauer hat klare Erwartungen an einen Film und verlangt von ihm ein erkennbares Konzept. Daher muss man ab dem Augenblick, in dem die Geschichte und ihr Weg definiert sind, an das Publikum und seine Erwartungen denken. Wenn der Autor da nicht mitspielt, wird es schwierig“, so Fabritius deutlich in Richtung Autoren. Für ihn gibt es keinen berechenbaren Erfolg im Kinobereich, aber er ist überzeugt, dass man mit einer guten Vermarktung einen stimmigen Stoff zu mehr Erfolg verhelfen kann. Dass es in Deutschland eher um das Geld, als um den Stoff geht, zeigte das Panel „Megaseller Made in Germany“ über die Verfilmung von Noah Gordons „Der Medicus“, ein Buch, das sich jahrelang jedem Verfilmungsversuch widersetzt hat. Der Film, der noch keinen Starttermin hat, ist gerade in der Postproduktion. Die Verfilmung musste sich zwei Zwängen unterwerfen: die lose, unfilmische Erzählung des im 11. Jahrhundert spielenden Buchs musste in eine Filmdramaturgie überführt werden und das Budget durfte 23 Mio. Euro nicht überschreiten. Bei früheren Anläufen war das Budget mal auf 36 Mio. Euro gesetzt gewesen. Also wurde die langatmige Reiseschilderung in eine dynamische Filmerzählung inklusive Liebesgeschichte voller Konflikte eingedampft. „Das Reiche und Wuchtige des Romans eignet sich gut für einen Kinofilm“, erklärt Regisseur Philipp Stölzl. „Die Kleinbogendramaturgie jedoch eignet sich besser für einen Fernsehmehrteiler.“ Die Frage des Formats stellte sich aber nicht, da Noah Gordon nur einer Kinoverfilmung zugestimmt hatte.
Großes Interesse fanden Gesprächsrunden und Präsentationen, die sich mit Fernsehserien beschäftigten. So musste „Innovatives Erzählen in der modernen TV-Serie“ in den größten Saal verlegt werden und sogar dieser war am Ende rappelvoll. Auch hier entsprach das Ergebnis der Diskussion der Erwartung: auf innovatives Erzählen in deutschen Serien wartet man weiterhin vergeblich. Der freie Producer und Autor Ron Markus berichtete, dass RTL zwar 16 Serienpiloten beauftragt hat, aber „bei allen deutschen Sendern konventionell gedacht wird“, so dass auch von diesen Projekten keine Überraschungen zu erwarten seien. Markus bedauert diese Haltung, denn „auch im deutschen Fernsehen kann man gebrochene Figuren erzählen, die zumindest emphatisch sind“. Warum es im deutschen Fernsehen nach wie vor nach Schema F geht, erklärte Sat.1-Redakteur Thomas Biehl: „Wir brauchen Figuren, an denen sich die Zuschauer emotional binden können. Wenn man nach Hause kommt, will man an die Hand genommen werden.“
Auch Bernhard Gleim, NDR-Redaktionsleiter Serie beim NDR, gab eine Idee davon, warum es in absehbarer Zeit so weiter gehen wird wie bisher: „In der deutschen öffentlich-rechtlichen Serie wird die Zuschaueridentifikation über eine vermittelnde Figur wie Staatsanwalt, Polizist, Lehrer oder Arzt hergestellt.“ Auch eine andere Anmerkung zeugt in diesem Sinne eher von Ideenlosigkeit, als von Erklärung: „Wo sind sie die deutschen Themen?“, fragte Gleim. In der Tat schaut man zu sehr mit Neid auf US-Serien und vergisst, dass sie so gut sind, weil sie mit Bravour Themen aufnehmen, die tief in der US-Gesellschaft verankert sind. Diese Themen für ein deutsches Publikum zu finden und zu behandeln, macht man sich in Deutschland im Serienbereich keine Mühe zudem die meisten der gehypten US-Serien Nischenprogramm sind. Das jedoch will sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht leisten. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Annette Hess, Autorin etwa der ARD-Erfolgsserie „Weißensee“, hat dem ZDF ein Format verkaufen können, das in den 50er Jahren spielt und das sie als „Mad Men im Wirtschaftswunder“ beschreibt.
Thomas Steiger
(MB 12/12_01/13)