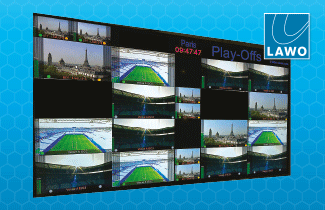MEDIEN BULLETIN sprach mit dem Chef des ZDFtheaterkanals, Wolfgang Bergmann, der gleichzeitig für ARTE und 3sat tätig ist – und ein HDTV-Fan ist – über die neuen Perspektiven und das Verhältnis zwischen Theater und TV.
Theater! Das ist ein Live-Erlebnis. Warum musste das in Form des ZDFtheaterkanals unbedingt ins Fernsehen rein? Sie sind ja schon seit der Anfangszeit 1999 dabei. Vielleicht, weil, wie schon Shakespeare sagte, „die ganze Welt eine Bühne ist“…?
Wie Sport und Fußball gab es auch schon das Theaterspiel vor der Erfindung des Fernsehens, und es wird auch nach dem Ende des Fernsehens Theater geben, da bin ich mir sicher. Also: niemand muss müssen, auch das Theater „muss“ nicht ins Fernsehen. Aber seitdem es Fernsehen gibt, hat sich eine wechselhafte Beziehung zwischen ihm und den Darstellenden Künsten herausgebildet. In der sich verändernden Medienwelt sind wir jetzt an einem bestimmten Scheideweg, wie intensiv die Beziehung zwischen Theater und Fernsehen in Zukunft weiter gelebt werden kann.
Konkret: Wie sieht die Beziehung speziell zwischen dem ZDFtheaterkanal als Fernsehen über Theater und Theater als originäre Darstellende Kunst heute aus?
Der ZDFtheaterkanal hatte zunächst primär eine Dokumentationsfunktion: Erstmals in der 2.500-jährigen Theatergeschichte hat das ZDF angestrebt, ein „visuelles Gedächtnis des Theaters“ aufzubauen. Das Gedächtnis fortzuschreiben, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die sich der ZDFtheaterkanal auf die Fahnen geschrieben hat. Die Reihe herausragender Theateraufzeichnungen, die wir in unseren Archiven haben, ist ja von außerordentlichem kulturhistorischem Wert und wird mit jedem Tag, mit jeder hinzugefügten Produktion wertvoller.
Sie sind nicht nur – wenn ich es so sagen darf – Chef des kleinen, quotenmäßig relativ unbedeutenden Theaterkanals, sondern gleichzeitig unter dem ZDF-Dach auch koordinierend bei ARTE und 3sat tätig. Was genau ist Ihre Aufgabe und was passiert da?
Der ZDFtheaterkanal und die Produktionen, die wir für ihn machen, sind für die gesamte Programmfamilie des ZDF bestimmt. 3sat und ARTE sind für die Produktionen wichtige Distributionsflächen mit einem eigenen Profil und mit eigenem Engagement im gesamten Bereich der Darstellende Künste und für Theater im besonderen Sinn. Dadurch, dass ARTE und 3sat erheblich weiter verbreitet sind als zurzeit der Theaterkanal, ist der Verbund existentiell wichtig dafür, dass wir die Programme erstens ökonomisch sinnvoll produzieren können und zweitens einem möglichst breiten Publikum vorführen können.
So wird das Theater aus dem ZDF-Hauptprogramm raus gehievt und in die Nische von Spartenkanälen gesteckt?
„Raus gehievt“ kann man nicht sagen. Die letzte Reihe einer vollständigen Theater-Inszenierung im ZDF Hauptprogramm ist schon Anfang der 90er Jahre eingestellt worden. Wir vom ZDFtheaterkanal haben dann dafür gesorgt, dass an der einen oder anderen Stelle auch im Hauptprogramm wieder vollständige Stücke gezeigt wurden: „Faust“, „Nibelungen“, „KÀ“ vom Cirque du Soleil oder Theaterfilme wie „Kabale und Liebe“ von Leander Haußmann. Gerade vor dem Hintergrund einer sich verändernden Medienlandschaft ist herauszuheben, dass gerade das ZDF solche Special-Interest-Programme vorhält. Also wir haben Theater eher wieder „rein gehievt“.
Sie haben kürzlich beim ZDFtheaterkanal die „100. Spielzeit“ gefeiert. Was heißt das?
„100. Spielzeit“ bedeutet, dass wir den hundertsten Programmschwerpunkt aufgelegt haben. Das Programm des ZDFtheaterkanals präsentiert sich in Programmpaketen, die in Schleifen strukturiert ausgestrahlt werden. Am Anfang der Geschichte des Theaterkanals sind diese Programmschwerpunkte sieben Wochen lang zu unterschiedlichen Zeiten wiederholt worden. Inzwischen ist diese „Spielzeit“ auf vier Wochen verkürzt worden, so dass wir im August unsere „100. Spielzeit“ feiern konnten. Schließlich soll man die Feste feiern wie sie fallen!
Der ZDFtheaterkanal hat ein mit 6,5 Millionen Euro sehr niedrig angesetztes Jahresbudget. Wie viele Neuproduktionen – Aufzeichnungen von Theaterstücken – konnten Sie in den vergangenen Jahren seit 1999 damit realisieren?
In Verbund mit 3sat und ARTE sind schätzungsweise 100 Aufzeichnungen entstanden, darüber hinaus viele Dokumentationen und Porträts und unser aktuelles Theatermagazin FOYER.
Nach der neuen ZDF-Digitalstrategie, die Ihr Intendant Markus Schächter angekündigt hat, soll der ZDFtheaterkanal zu einem „Kulturkanal“ ausgebaut werden. Welches Konzept haben Sie dafür?
Die Frage lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret beantworten. Zurzeit gibt es im Hause ZDF noch einen laufenden Prozess der inneren Vergewisserung, auch im Dialog mit den Aufsichtsgremien und der Medienpolitik. Es liegt noch kein klares Ergebnis vor, zumal die neue Grundausrichtung des Kulturkanals auch von der wirtschaftlichen Ausstattung des Programms abhängig sein wird. Sicher ist: Wir werden der Programmstruktur einen erweiterten Kulturbegriff zugrunde legen. Wir werden andere Sparten der schönen Künste in das Programm aufnehmen und als öffentlich-rechtlicher Sender zusätzliche Anstrengungen im Bereich Bildung unternehmen. Wir wollen einen neuen Zugang zu einem jüngeren Publikum eröffnen. Das ist eine ganz spannende Aufgabe für die Zukunft! Wir werden neue Formate entwickeln, mit denen wir kulturelle und bildende Inhalte verstärkt für ein junges Publikum zugänglich machen.
Nicht für den ZDFtheaterkanal, sondern für ARTE haben Sie mit „Europas Erbe – Die großen Dramatiker“ ein schönes Projekt inszeniert. Da wurden bereits im vergangenen Jahr von ARTE-Zuschauern aus einer Liste von 50 Dramatikern die zehn Besten ausgewählt. Von diesen zehn Besten – unter anderen Sartre, Brecht, Goethe, Shakespeare – werden zurzeit bis zum 19. September recht unterhaltsame Porträt-Dokumentationen ausgestrahlt, und die Zuschauer sollen dann entscheiden, wer der tollste Dramatiker ist. Wäre dieses Projekt auch ein vergleichbarer Schritt für den jetzigen Theaterkanal, in die Richtung, Hochkultur aus dem Elfenbeinturm herausholen und populärer zu machen, indem ein spielerisches Element wie bei RTLs DSDS für die Vermittlung von kultureller Bildung verwendet wird?
Ich muss erst einmal korrigieren: Nicht DSDS, sondern das Theater hat eine solche Form erfunden. Das waren die Dionysyen vor rund 2500 Jahren, als die Dramatiker im Wettbewerb gegeneinander angetreten sind, und das Publikum entschieden hat, wer der Beste ist. Das war, wenn Sie so wollen, „Griechenland sucht den Superdramatiker“. Natürlich müssen wir uns auch mit spielerischen Formen substanziell wichtigen Inhalten nähern. Davor scheuen wir uns nicht. Ich denke, dass eine Form, wie wir es mit „Europas Erbe“ erproben, sinnvoll ist. Denn wir müssen und wollen kreativer werden in unserer Vermittlung.
Dann müsste allerdings, der aktuelle Etat vom jetzigen Theaterkanal hin zu einem Kulturkanal erheblich aufgestockt werden?
Man soll Wunder nicht ausschließen.
Bei einem Gespräch anlässlich Ihrer 100. Spielzeit hatten Sie die Bemerkung fallen gelassen: „Wir sehnen uns nach HDTV“. Meinen Sie, HDTV könnte perspektivisch neue Impulse für kulturell geprägte Fernsehsender geben?
ARTE wird ja bereits in High-Definition ausgestrahlt. Streng von der Qualitätsseite betrachtet erwarte ich außerordentliche Impulse von High-Definition für den ganzen Bereich Performing Arts. Wir produzieren schon seit geraumer Zeit – insbesondere Musikprogramme, aber zunehmend auch Theaterprogramme – in High-Definition, und unsere Dokumentationen sowieso. Wer sich eine Opern-Inszenierung mal mit einer Surround-Sound-Anlage und auf einem schönen großen Bildschirm in HD-Qualität angesehen hat, wird bestätigen, dass das ein ganz anderes Erlebnis ist. Es kommt schon fast ein bisschen einem Logenplatz im Theater nahe. Außerdem werden ganz andere Kamera-Einstellungen möglich. Insofern glaube ich, dass High-Definition tatsächlich den Performing Arts-Programmen entgegenkommt. Umgekehrt ist ein Performing Arts-Programm sicher auch ein Kaufimpuls für den einen oder anderen Opernliebhaber und Freund der Schönen Künste, sich mit entsprechender Hardware auszustatten, um das Angebot auch wahrnehmen zu können.
Deutschland hat die vielfältigste Theaterlandschaft in Europa und vermutlich sogar weltweit. Wer ins Theater geht – zumal hier in Berlin – stellt fest, wie stark neue Medientechnologien im Theater selbst genutzt werden. Nicht nur Video als dekorative Hintergrund-Leinwand, sondern zum Beispiel auch Live-Aufzeichnungen von Videokünstlern, die eine zweite Spielebene und vierte Dimension auf die Bühne bringen, wie etwa bei Frank Castorf an der Berliner Volksbühne…
In dem Maße, wie das Bewegtbild – Fernsehen, Video – zu unserer Wirklichkeit und unserer Sprache allgemein gehören, in dem Maße tauchen die Techniken auch auf der Bühne immer wieder auf. Und dann auch in der Adaption von Bühnenarbeiten und in der Auseinandersetzung mit Bühnenarbeiten im Fernsehen. Das ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung von Sprache und Formen, ein Reflex auf eine sich weiter entwickelte Formensprache – im Theater wie auch in den Medien. Trotzdem verbergen sich in dieser alten Beziehung von Theater und Fernsehen viele interessante neue Themen. Ende November werden wir in der Akademie der Darstellenden Künste in Baden-Württemberg, die ich leite, diesem Thema ein Festival widmen. Da werden internationale Experten unter dem Titel „Stage on Screen – Screen on Stage“ all diese Phänomene beleuchten und ihnen wissenschaftlich nachgehen. Da wollen wir den Blick über den Tellerrand wagen und herausfinden, was in Europa und darüber hinaus auf diesem Gebiet der Auseinandersetzung zwischen Medien und der Darstellende Kunst aktuell ist.
Sie sind sowohl ein Theater- als auch ein TV-Experte. Was ist für Sie das Schönere – Theater oder Fernsehen?
Die Frage, was schöner oder nicht schöner ist, stellt sich mir nicht. Feststellen kann man aber schon, dass Theater das existenziellere Bedürfnis von Menschheit repräsentiert. Es hat im Gegensatz zum Fernsehen schon viele tausend Jahre auf dem Buckel…
Und es ist auch Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die Kultur, die im Lande ist, zu fördern?
Selbstverständlich gehört die Kultur zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, und deshalb machen wir das auch. Man kann das ZDF nicht hoch genug loben, dass es sich gegen alle Quotendiktate durchgehend anhaltend für die Darstellenden Künste engagiert. Nur das ZDF hat einen Theaterkanal gegründet, sonst niemand.
Erika Butzek (MB 10/08)