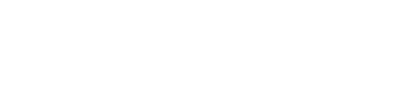Dabei wurde ebenso eine für Deutschland recht ungewöhnliche Produktionsweise auf die Beine gestellt, erklärt Kathrin Breininger im Gespräch mit MEDIEN BULLETIN. Breininger ist kreative Produzentin bei Hofmann & Voges und der „Showrunner“ beim Kriminaldauerdienst.
Für ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut ist die neue Serie „KDD – Kriminaldauerdienst“ ein ganz wichtiges Projekt auf seiner Experimentschiene, die dem ZDF-Modernisierungsprozess dient. Was macht KDD so besonders, was ist die Grundidee?
Die Idee wurde schon in 2001 geboren. Da saß ich zum ersten Mal mit dem Autor Orkun Ertener zusammen. Unsere Grundidee war, die Polizei einmal aus einer ganz anderen Sicht darzustellen: nicht als Ermittlerduo oder als einzelne Ermittler, sondern als ganze Schicht. Wir wollten die Menschen, die hinter der Funktion „Polizei“ stecken, charakterisieren vor dem Hintergrund, dass sie tagtäglich den Tod vor Augen haben, es äußerlich regeln müssen, aber innerlich ertragen.
War das Vorbild die US-Serie „The Shield“, wo es ja auch um ein Polizeirevier geht?
Überhaupt nicht, denn „The Shield“ gab es da noch gar nicht! Nach der Grundidee haben wir die Geschichten so lange entwickelt, bis die Bücher so waren, wie wir sie haben wollten. Wir haben das Projekt dem ZDF angeboten und relativ schnell, schon zwei Monate später, kam die Antwort, dass das ZDF es gerne weiterentwickeln würde. Ungefähr um die Zeit bin ich auch auf „The Shield“ aufmerksam geworden. Ich fand den Look großartig, weil er eine so große Nähe erzeugte, so dass ich als Zuschauer mitten im Geschehen dabei war.
Bevor wir zum Look kommen: War Ihre Grundidee, das deutsche Krimi-Genre zu revolutionieren?
Ich sehe KDD nicht im Krimi-Genre, sondern als ein Polizei-Drama. Es gab die Angst, die differenzierte Bezeichnung könnte den Zuschauer verschrecken. Ich kann aber gut damit leben, wenn KDD in die Krimi-Schublade gesteckt wird.
Es geht ja auch nicht um die Auflösung von Kriminalfällen, sondern um Menschen, Charaktere im Job, um verschiedenste Lebensarten, um fließende Grenzen zwischen Gut und Böse und viele parallele Handlungsstränge: um ein „Lebensmosaik“, wie Sie formulierten. Die Location dafür könnte man vermutlich genauso gut in einer Bank oder im Krankenhaus ansiedeln?
Genau richtig. Es war schon auch ein wenig die Idee, „Emergency Room“ im Polizeirevier zu schaffen: Wir wollen viele verschiedene Typen von Menschen und deren Schicksale erzählen.
Das KDD-Drama ist relativ düster – oder auch hart aber ehrlich. Was hat Ihnen die Hoffnung gegeben, dass es dennoch beim Fernseh-, also Massenpublikum ankommt?
Ob es zu düster ist, darüber habe ich nicht nachgedacht. Allerdings haben wir schon versucht, ab und zu einen Funken Hoffnung aufblitzen zu lassen, um das alles nicht ganz so dramatisch oder tragisch werden zu lassen. Aber eigentlich ist es ein Konzept gewesen, an das wir geglaubt und gehofft haben, das es auch den Zuschauer interessiert, ihn begeistert und einen Sog auf ihn ausüben kann.
Was macht KDD attraktiv im Vergleich zu herkömmlichen deutschen TV-Serien?
Wir bieten den Zuschauern interessante Charaktere, die nicht berechenbar sind. Alles ist möglich, alles kann passieren. Nichts ist vorhersehbar. Das ist echt! Und das ist das Besondere!
Es ist aber auch ein Risiko, wenn man dem Zuschauer zumutet, sich konzentrieren zu sollen anstatt ihm Schema F-Geschichten schnell konsumerabel fürs Herz zu präsentieren?
Da muss man einfach mal den Mut zu haben, auch Themen anzugehen, die nicht oberflächlich breitenwirksam daher kommen. Ansonsten müssten wir ja immer weiter das sehen, was es schon seit Jahren gibt, Bügelfernsehen, das man nebenbei konsumieren kann, weil man den Handlungsstrang schon mehr oder weniger kennt: am Anfang eine Leiche, am Ende ist der Fall gelöst und alle sind zufrieden und der Detektiv kann sich um seine Familie kümmern. Wir wissen, dass es funktioniert, aber selbst da sind die neuen Formate in den letzten Jahren nicht besonders gut angekommen, und deshalb muss man mal was ganz anderes machen.
Zwei Kameras, ein Licht, alle voll da
Wie kommt der intime Look bei KDD zustande?
Wir haben durchgehend mit zwei Kameras gedreht, mit Handkamera und Steady-Cam, keine Schienen, keine Stative. Die Schauspieler hatten keine Markierungen oder andere einengende Vorgaben, wie sie eine Szene zu spielen hatten. Das Licht war für den Raum gesetzt und nicht für einzelne schöne Gesichter oder leuchtende Haarspitzen. Und dann haben sie losgelegt. Die Kameras hatten die Aufgabe, darauf zu reagieren. Niemand wusste, wann er tatsächlich dran ist, oder wie man es am Ende schneidet. Alle mussten immer voll da sein. Dadurch entstehen diese Nähe zu den Figuren und die Authentizität.
Keine strikte Drehbuch-Vorgabe?
Natürlich gab es Drehbücher. Aber die Schauspieler legen sich selber ihre Texte immer ein bisschen zurecht. Es ist nicht alles improvisiert, sondern es steht schon sinngemäß im Drehbuch. Nur haben wir eine gewisse Lockerheit im Spiel zugelassen. Wenn man nicht ganz so strenge Vorgaben macht, kommt mit den richtigen Darstellern Wahrhaftigkeit heraus.
Der Kameramann muss dabei dann aber wohl sehr auf Zack sein?
Der Kameramann muss die ganze Zeit hellwach sein, was die wunderbare Kamera von Sonja Rom fantastisch gemacht hat: erfühlen, was gerade das Wichtigste ist, wo man nah ran geht oder schnell rüber reißt.
Man braucht Kameramänner mit einer neuen spontanen, reportagemäßigen Sensibilität?
Ja, das hat ihnen aber auch viel Spaß gemacht, wie auch den Regisseuren. Obwohl es natürlich anstrengender ist als normalerweise. Jede Szene wird wieder ein bisschen anders und man kann sich nicht zu hundertprozentig sicher sein, ob man alles im Kasten hat. Es ist aber eine Herausforderung.
Die Finanzierung war so, dass Sie Luft dafür hatten?
Wir sind etwas über den Rahmen hinausgeschossen. Bei der ersten Staffel muss man es sich aber auch mal leisten können.
Wie ist gedreht worden? Das ZDF setzt ja mittlerweile stark auf HD…
16mm, kein HD. Die etwas düstere, schmutzige Atmosphäre würde man zumindest zurzeit so noch nicht hinbekommen.
Sie haben die Funktion des „Showrunner“ als besonders wichtig für das Projekt hervorgehoben, dass also ein einzelner kreativer Kopf die Idee der Serie vom Drehbuch über Organisation bis zur Realisation leitet…
Der Showrunner, das bin ich selbst, weil ich von Anfang an dabei war, um eine Vision zu verfolgen. Hinzugekommen sind dann eine Menge besonderer Menschen – da habe ich mir auch viel Mühe gegeben: von der Casterin über den Szenenbildner, den Regisseuren und Darstellern bis zu den Musikern. Wenn aber so viele kreative Menschen auf einem Haufen sind, ist die Gefahr bei Serien immer groß, dass jede Folge von einem anderen Regisseur ganz anders aussieht, weil immer noch eine neue Idee hinzukommt. Ich wollte aber zwölf Folgen schaffen, die in Bezug auf ihre atmosphärische Wiedererkennbarkeit aus einem Guss sind. Um das zu erreichen, muss man immer wieder kommunizieren, motivieren, verbinden und im Sinne des Projekts, das man sich einst überlegt hatte, auch einige neue Ideen wieder unterdrücken. Es sind Bauchentscheidungen, denen man treu bleiben muss. Man muss der Vision treu bleiben, darf nicht alles laufen lassen. Ich finde, es ist ganz gut gelungen, und man merkt auch noch in der zwölften Folge noch, dass die Idee von der ersten Folge nicht vergessen ist.
In der Funktion des Showrunners bleiben Sie dann ja viel dichter am Geschehen dran als es normalerweise bei Produzenten üblich ist?
Ich hoffe, dass es bei Serien immer üblicher wird. Ich finde es auch schade, dass der Produzent immer als derjenige gesehen wird, der alles finanziert, und andere kreative Leute sind dann für die Realisierung verantwortlich. Ich kümmere mich gerne um die kreative Seite.
Vorbild Creator
Dabei orientieren Sie sich am amerikanischen Modell – „Showrunner“ ist ja kein deutscher Begriff?
David E. Kelley [„Chicago Hope“, „Ally McBeal“, „Boston Legal“ – Anm. d. Red.] ist das große Vorbild. In Amerika gibt es viel größere Autorenteams, die unter einem Creator arbeiten. Der Creator ist nicht nach der Buchentwicklung wieder weg, sondern kümmert sich auch um die Auswahl der Regisseure, um die Besetzung, so dass das, was er sich beim Buch überlegt hat, auch bei der filmischen Umsetzung nicht verloren geht.
KDD – Kriminaldauerdienst: Wird daraus auch eine Dauereinrichtung beim ZDF?
Von mir aus kann es zwanzig Jahre laufen. Die Ideen haben wir. Natürlich ist es immer eine Frage, wie sich die Quote entwickelt. Ich denke, dass die Chance sehr gut steht, dass es eine zweite Staffel geben wird.
Was sagt die Medien- und Quotenforschung dazu, haben Sie ein besonderes, vielleicht jüngeres Publikum erreicht?
Eine genaue Datenbasis haben wir noch nicht. Sicher ist nach Ausstrahlung der dritten Folge nur: Die Leute, die eingeschaltet haben, haben nicht ausgeschaltet, sondern sind bis zum Ende dran geblieben. Aber aus welchen Schichten sie sich zusammensetzen, dazu haben wir noch nicht genug Erfahrungswerte.
Ist KDD auch wieder ein Kopiervorbild für den deutschen Fernsehmarkt oder ein uniques Format für den Sendeplatz beim ZDF?
Jedes Format soll selbst für sich die Faszination entwickeln. Ich halte es nicht für clever, zu sagen, das hat funktioniert, jetzt machen wir es noch einmal für einen anderen Sendeplatz.
Ein jeweils einzigartiges Format zu entwickeln, ist das auch die Definition von Qualitätsfernsehen bei Hofmann & Voges?
Ja, absolut. Man muss immer wieder neue Ideen haben. Man sollte sich inspirieren lassen von allen Ländern, nicht nur von den USA, auch die Briten machen tolle Sachen, ich mag auch den „Adler“ aus Dänemark sehr gerne. Man sollte Inspirationen in sich aufsaugen und daraus etwas Neues entstehen lassen.
Erika Butzek (MB 03/07)