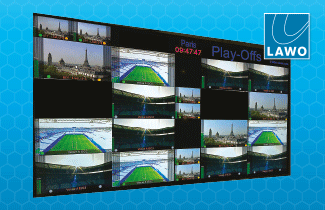Auch wenn es explizit nicht so bezeichnet worden ist, stand im inhaltlichen Mittelpunkt des Symposiums ein neuartiger ideologischer Konflikt. Überspitzt: Soll man nach Silicon-Valley-Vorbild dem unregulierten digitalen Turbo-Kapitalismus im Internet, den man neuerdings „Libertarismus“ nennt, auch in der EU mehr oder weniger freien Lauf lassen, um so europäischen Start-ups gegenüber der globalen Konkurrenz größere Chancen zu geben? Folge könnte sein, dass auch Medien und andere kulturelle Güter zu industriellen Waren auf Handelsplattformen mutieren. Oder muss die nationale und europäische Politik im Gegenteil dafür Sorge tragen, dass auch im Internet die bislang für die analoge Welt geltenden Regularien erhalten bleiben? Ziel wäre es dabei, Medien weiterhin der Kultur unterzuordnen, so dass sie der Meinungsvielfalt wie dem freiheitlichen Demokratieverständnis in unserer Gesellschaft dienen und die Grundsätze einer nationalen und sozialen Marktwirtschaft erhalten bleiben. Der Konflikt ist durch Friktionen entstanden, die sich aufgrund der digitalen Transformation der Gesellschaft ergeben. Die ideologische Auseinandersetzung dazu zieht sich mittlerweile quer durch alle Parteien und wurde auf dem Symposium von zwei Mitgliedern der CDU ausgetragen.
Auf der einen Seite: Günther Oettinger (61). Er war ab 2005 fünf Jahre Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, bevor er EU-Kommissar für Energie wurde und neuerdings als EU-Digitalkommissar unter dem heutigen EU-Präsidenten und ehemaligen Premierminister von Luxemburg, Jean-Claude Juncker, die Aufgabe übernommen hat, „einen digitalen Binnenmarkt für Verbraucher und Unternehmen“ zu schaffen. Das ist die erste der fünf Prioritäten, die sich Juncker für seine fünfjährige Amtszeit gesetzt hat. Juncker hofft durch „grenzenlose Ausschöpfung des Potentials der digitalen Technologien“ mehr Wachstum und Beschäftigung in der EU generieren zu können. Voraussetzung dafür sei, wie er auf seiner Homepage schreibt, „bisher national isolierte Systeme in der Telekommunikationsbranche, im Urheber- und Datenschutzrecht zu durchbrechen“. Genau das ist Oettingers Aufgabe.
Auf der anderen Seite: Prof. Monika Grütters (53), seit 2005 Mitglied des deutschen Bundestages. Ob in ihrer beruflichen Laufbahn oder als Berliner- und Bundespolitikerin hat für Grütters immer die Kultur und Bildung im Fokus gestanden. Unter Bundeskanzlerin Angela Merkel ist sie 2013 zur Staatsministerin für Kultur und Medien avanciert. Ihre Aufgabe und Kompetenz wird dabei allerdings auf etlichen Ebenen dadurch determiniert, dass Kultur und Medien mehr in der Hoheit der Länder und nicht des Bundes stehen. Aber in Bezug auf die Entwicklung eines den bisherigen Regularien übergeordneten Medienstaatsvertrags seitens der neu konstituierten Bund-Länder-Kommission für Medienkonvergenz hat Grütters für den Bund den Vorsitz übernommen, neben Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die die Kommission seitens der Länder koordiniert. Oettinger und Grütters skizzierten auf dem Symposium ihre strategische Positionen und Zielsetzungen.
Mit der Bildung eines digitalen EU-Binnenmarktes, machte Oettinger klar, wolle man sich insbesondere gegen die digitale Überlegenheit der USA wehren, die durch die Kapitalstrategie der fünf Big Player Google, Facebook, Amazon, Apple und Microsoft zu Stande gekommen sei. Ebenso wichtig sei es für Europa im digitalen Bereich gegenüber China und Südkorea seine Stärke zu halten, „ohne die eigene Kultur aufzugeben“, betonte Oettinger zunächst. Die digitale Revolution werde sich in den nächsten fünf Jahren beschleunigen, prognostizierte er. Vor diesem Hintergrund müsse vorrangiger „EU-Ehrgeiz“ sein, hinsichtlich der dadurch entstehenden Arbeitsplätze eine gute Position zu erhalten „und ein bisschen auch unsere Kultur und unser Menschenbild“. Bei aller Fragilität gebe es zwar in der EU eine gemeinsame Währungsgemeinschaft, im Gegensatz zur USA aber keinen digitalen Binnenmarkt. Deshalb stünden europäische Start-ups vor einem Regulierungs-Dickicht. Beispielsweise mit 28 fragmentierten Datenschutzgesetzen in Europa, sei man „zu stark reguliert“. Das deutsche Leistungsschutzgesetz, das die Verleger hierzulande gegen Google durchgesetzt haben, sei zwar „gut gemeint, aber unnütz“. Vielmehr müsse man erreichen, dass „wer in der EU handeln will, unsere Regeln beachten muss“. Man wolle ein „Level Playing Field“ für eine digitale Union etablieren, an das sich auch Google und Co. halten müssten. Zurzeit gebe es „keinen fairer Wettbewerb“, sondern eine „schiefe Ebene“. Gegen Google als Buhmann für die eigene Wettbewerbs-Benachteiligung haben sich seit langem deutsche kommerzielle Medienunternehmen wie etwa ProSiebenSat.1 oder Springer eingeschossen, im Gegensatz allerdings zur deutschen IT-Wirtschaft, vertreten durch den mächtigen Verband Bitkom (s. Beitrag Google i.d.A.). Die Vormachtstellung der Intermediäre (wozu neben Google beispielsweise auch die Social Media-Unternehmen eingerechnet werden) sei „erheblich“, referierte Oettinger, wohl wissend, dass er in diesem Punkt Grütters Einverständnis hat. Sie betonte wieder, dass „Auffindbarkeit von Inhalten zur zentralen Währung im Netz“ geworden ist und Intermediäre „nicht nur Datenmonopole“, sondern auch „Deutungs- und Meinungsmonopole bilden“.
Grütters sieht neben Chancen vor allem viele negative Effekte des Internets, etwa verantwortungslose Verbreitung von Meinungen, Stimmungsmache, Unwahrheiten, Verschwörungstheorien, totale Überwachung, die die partizipative Funktion des Internets überschattet. Damit würden die schwer errungenen Konventionen einer freiheitlichen Demokratie torpediert. Dem gegenüber betont Oettinger ein wirtschaftliches Gut: Mit „500 Millionen Verbrauchern“ – viel mehr übrigens als in den USA – gebe es in der EU ein riesiges „digitales Publikum“. Oettinger geht es um die neue Industrie, die durch das Internet möglich wird, und hat deshalb mehr die vorhandenen und neu entstehenden Handels- denn Medien- und Kommunikationsplattformen im Visier. Neu auf dem DLM-Symposium war, dass er betonte, man müsse für den neuen digitalen EU-Binnenmarkt eine „faire Balance“ im Urheberecht zwischen den Kreativen als Urheber, den Händlern und Programmgestaltern und den Internet-Nutzern finden. Denn, wenn es wertlos werde, Ideen im Internet originär zu kreieren, werde das Interesse an einer kreativen Berufsausübung aussterben und man müsse „auch noch in 50 Jahren mit Udo Jürgens leben“, obwohl wir „einen Neuen brauchen“, betonte Oettinger populistisch.
Vor allem aber machte Oettinger Druck auf die deutsche Medienpolitik. Es gehe bei der Digitalisierung „um Geschwindigkeit“. Deutschland sei „zu langsam“, um auf die US-Giganten reagieren zu können. „Erst 5 nach 12“, werde dem EU-Rat mitgeteilt, was man will. Er kündigte abermals an, man werde nicht nur bereits im Mai eine Strategie für den EU-Binnenmarkt vorlegen, sondern Ende des Jahres einen Gesetzgebervorschlag für digitales Urheberrecht und für eine Datenschutzregelung vorlegen, an die sich unter anderem Google werde halten müssen. Eine Novellierung der EU-Richtlinie für audiovisuelle Medien sei in Vorbereitung und werde spätestens im ersten Quartal 2016 vorgelegt, wobei sich als Zielfrage herauskristallisiert habe: „Wo muss man überhaupt noch regulieren?“ Spätestens mit der Etablierung des neuen Mobilfunkstandards 5G sei es ohnehin ab 2018 mit nationalen Konzepten vorbei, weiß Oettinger aufgrund seines jüngsten Besuchs der Mobilfunkmesse in Barcelona.
Grütters weiß natürlich, dass das EU-Recht dem nationalen übergeordnet ist und hat die Herausforderung des EU-Tempodrucks angenommen. Bereits Ende des Jahres werde die Bund-Länder-Kommission erste Vorschläge für Regularien in der konvergenten Medienwelt vorlegen: zu einer effizienten Plattformregulierung, zur vielfaltssichernden Regulierung von Intermediären und eine bessere Abstammung zwischen Markt- und Meinungskontrolle. Zudem arbeite man auch an einer raschen Revision der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste. Input für ein angepasstes Urheberrecht hat Grütters längst gegeben. Der Umgang mit dem Internet, so hatte Grütters zuvor referiert, sei ein „untrüglicher Indikator für das staatliche Demokratieverständnis“. Sie wies darauf hin, dass mittlerweile das Unbehagen am Internet wachse, weil es „zuweilen mehr Freiheiten ermöglicht, als die Demokratie vertrage“. Man habe in Deutschland „aus zwei Diktaturen in einem Jahrhundert die Lehre gezogen: Kultur und Wissenschaft sind frei“. Diese Freiheitsrechte seien „nicht verhandelbar, unabhängig von analoger oder digitaler Welt“. Grütters wörtlich: „Wir dürfen nicht einigen wenigen globalen Internetakteuren die faktische Hoheit darüber überlassen, wie und worüber wir uns zukünftig informieren und wie wir miteinander kommunizieren. Wir haben in Deutschland – auch aus unserer historischen Verantwortung heraus – eine fein austarierte Medienordnung, die es zu verteidigen, zu erhalten und weiterzuentwickeln gilt. Die Zeit hierfür drängt“.
Wie man nationale Kulturpolitik und EU-weite Industriepolitik in einem digitalen EU-Binnenmarkt unter einem Dach vereinbaren kann, dürfte eine Herkulesaufgabe sein. Schlimmer noch: Man steht bislang vor der Quadratur des Kreises und hofft auf eine Deus-ex-Machina-Lösungsidee. Und genau die hat Dr. Jürgen Brautmeier, Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM), parat: Der Staat müsse „keine Regulierung vorgeben“, so Bräutigam in seiner Begrüßungsrede. Seiner Auffassung nach ist demnach bislang im Internet alles prima gelaufen. Er meint, eine „Ex-post-Regulierung“, also eine Regulierung, wenn schon etwas schief gelaufen ist, sei „besser“. Es sei „wichtiger zu produzieren und zu entwickeln als zu regulieren und diskutieren“. Der Staat müsse sich auf eine „begleitende und nachgelagerte Gestaltung“ der Medienentwicklung beschränken. Und wer soll dafür verantwortlich sein? Na klar: die DLM.
Erika Butzek
MB 3/2015
© Andreas Franke / panabild.de